|
|
|
 
Wie ich mit dem Rauchen aufgehört habe
|
|
Ich habe sehr früh angefangen zu rauchen. Meine Eltern qualmten beide. Meine Mutter war der Meinung, dass, wenn das Kind zu Hause nicht rauchen darf, es das draußen heimlich tun würde. So hätten die Eltern wenigstens die Kontrolle. Ich habe also zu Hause geraucht und zusätzlich draußen heimlich. Zigaretten waren damals noch erschwinglich. Ich erinnere mich an Jubilar, Casino, Real und Juwel, an die teurere Orient mit dem Goldmundstück, an Karo, F6, Cabinet und natürlich Club. Ich rauchte nach dem Aufstehen während des Kaffeekochens, zum Kaffee, beim Schminken und schnell noch eine vor dem Losgehen. Erst viel, dann mehr und schließlich wie ein Schlot. Zunächst reichte eine Schachtel, dann mussten es mehr sein; später waren zwei Schachteln pro Tag die Regel. Das gab mir zu denken, und immer wieder drängte sich der Wunsch auf, von der Zigarettensucht loszukommen. Ich habe "hundertmal" aufgehört. Damit hatte ich kein Problem. Zwei Tage, zwei Wochen, zwei Monate lang. Zwei Jahre schaffte ich allerdings nie. Nun braucht es ja triftige Gründe, um ernsthaft aufzuhören, und davon gab es viele: Rauchen stinkt, es klaut Zeit, es kratzt im Hals, brennt in den Augen, es macht Husten, es kostet Geld. Die Finger und Gardinen werden gelb. Lungenkrebs droht. Leider verblasst die Erinnerung an all diese Widrigkeiten während der Abstinenz in sehr kurzer Zeit. Die Erinnerung an den Genuss und die Geselligkeit gewinnt die Oberhand. Die Sehn-Sucht wird übermächtig. Wenn dann die Versuchung hinzukommt, wird das Durchhalten immer schwieriger. Es ist also nicht das Aufhören, sondern das Nicht – wieder- Anfangen, an dem man
scheitert. Deshalb habe ich mich gefragt: Wie kann ich das verhindern? Wie kann ich mich überlisten und das Rauchen "entglorifizieren"? Plötzlich kam die Idee: Ich nahm mir vor, der Versuchung einfach nicht zu widerstehen. Ja, genau! Ich kaufte mir eine Schachtel guter Zigaretten, steckte sie in die Tasche und freute mich darauf, am Abend, in aller Ruhe und allein, die erste Zigarette anzuzünden und mit Genuss zu rauchen. Es war nicht schwer, bis zum Abend zu warten. Vorfreude ist ja die schönste Freude. Ich stellte mir nur eine Bedingung: Ich würde die ganze Schachtel, eine Zigarette nach der anderen, rauchen und mir dabei sagen müssen, wie schön doch das Rauchen ist. Was für ein Genuss! Letzteres gelang mir noch bei der 3. Zigarette, die 4. schmeckte schon nicht mehr gar so gut. Die nächsten wurden unangenehm bis widerlich im Geschmack. Die Zunge begann zu brennen, der Kopf war benebelt. Nach der zehnten wurde es schwierig, mit dem Ziel 20 vor Augen, weiterzumachen. Ich zwang mich aber bis zum Ekel durchzuhalten. Dann räumte ich alles weg, vernichtete, endlich erlöst, die übriggebliebenen Zigaretten, wusch den Aschenbecher aus und versteckte ihn, putzte mir die Zähne, lüftete die ganze Wohnung und sog auf dem Balkon die frische Luft genüsslich ein. Die Erinnerung an das Rauchen ließ mich schaudern. Nach etlichen Tagen verblasste auch diese schlechte Erfahrung. Das Verlangen wuchs allmählich wieder. Also musste die "Rosskur" wiederholt werden. Nur dreimal habe ich das so tun müssen, dann hatte ich schon beim Gedanken an das Rauchen nur noch unangenehme Gefühle. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Ich habe noch nie wieder Verlangen danach verspürt. |
|
|

Antje

Karin

Susanne 
Christiane mit Antje
|
Puppenzeit
Einmal las ich in einem Kinderbuch von einem niedlichen Mädchen
mit dicken blonden Zöpfen. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber
sie war immer ordentlich gekämmt und trug hübsche Kleider zu
weißen Kniestrümpfen und schwarzen Lackschuhen. Dieses Mädchen
hatte viele Puppen, und jedes Puppenkind hatte einen eigenen
Namen. Morgens wurden sie gewaschen, angezogen und gefüttert,
tagsüber spazieren geführt und abends wie richtige Kinder mit
einem Gute Nacht- Kuss zu Bett gebracht. Ich schaute mir meine
Puppen an und stellte fest, dass sie sich in einem
erbärmlichen Zustand befanden. Von nun an sollte sich das
ändern, beschloss ich. Ich setzte sie in einer Reihe auf mein
Bett: Karin, Sybille, Antje und Susanne. Die Namen hatte ich mir
gerade ausgedacht bis auf Antje. Die hieß schon immer so. Antje
war meine älteste Puppe mit langen blonden Löckchen. Mutti hatte
sie mir von ihrer Kur in Heiligendamm mitgebracht, als Trost für
das lange Ohne- sie- Sein. Wenn man Antje nach vorn beugte und
wieder zurück, dann kam ein kläglich dünnes "Mama" aus ihrem
Bauch. Ich holte Kamm und Bürste: "Du hast Dich ja schon wieder
nicht gekämmt, Sybille", stöhnte ich vorwurfsvoll. Aber ich
wollte doch nicht schimpfen, fiel mir im gleichen Moment ein,
sondern ganz lieb sein zu meinen Kindern, wie das blonde Mädchen
mit den beneidenswerten dicken Zöpfen.
Meine mausgrauen Haare flogen dagegen in Fransen dünn und glatt
um den Kopf herum. Schon so oft sollten sie ganz lang wachsen,
doch spätestens, wenn sie sich seitlich zu teilen begannen, weil
die Ohren hinter dem spärlichen Vorhang nicht genug Platz
fanden, ließ ich sie abschneiden. Damit ich nicht immer aussah
wie ein Bengel, versuchte meine Mutter es wieder und wieder mit
einer Dauerwelle, die mich jedes Mal noch mehr verunstaltete,
wie ich fand. Immer war ich ganz unglücklich und hätte doch so
gerne dicke lange Zöpfe oder wenigstens einen frech wippenden
Pferdeschwanz gehabt. Nicht die kleinste Locke wand sich an
meinem Kopf.
Also kämmte ich die schwarzhaarige Sybille mit dem glatten
Pagenschnitt ganz sanft und holte den Waschlappen, damit auch
Karin, deren Haarpracht auf dem Zelluloidkopf nur aufgemalt war,
ansehnlicher würde. Die etwas klein geratene Susanne war ganz
nackt. Deshalb steckte ich sie erst mal ins Bett. Sie war eben
krank. Ich strich ihr mit den Fingerspitzen über die schmale
Stirn und fühlte: "Oh ja, Fieber. Ganz heiß bist du. Bleib schön
zugedeckt. Gleich hole ich dir das Steckspiel mit den bunten
Perlen. Möchtest du Sauerkirschkompott oder lieber Apfelmus?"
Antje hatte die schönsten Anziehsachen. Sie durfte erst mal
bleiben wie sie war. Für die anderen wollte ich alle
Puppensachen zusammensuchen, die ich auftreiben konnte. Mein
einziger Schrank war ungefähr einen Meter hoch und sechzig
Zentimeter breit und blaugrau gestrichen. Darin purzelte alles
durcheinander: Bücher, Autos, Plastikpuppengeschirr,
Holzbausteine und Teile vom Stabilbaukasten, ein Löffel, ein
angebissenes und vertrocknetes Brötchen, Angelsehne und Haken,
eine winzige Nuckelflasche mit dem verklebten Rest von bunten
Liebesperlen, mein Taschenmesser und Staub in Hülle und Fülle.
Dazwischen fand ich Röckchen, Kleidchen, Jäckchen, Höschen -
verknuckelt und verknorkelt.
Wie war das bei der Puppenmutti aus dem Buch? Da hatte alles
seinen Platz, war blitzsauber. Die Kleidchen hingen in einem
Extraschrank auf kleinen Bügeln. Die Kinder trugen Schlafanzüge
zum Schlafen. Jedes lag in einem Bettchen mit weichen Kissen und
rüschenbesetzten Deckchen.
In meinem einzigen Puppenbett lagen unangespitzte, lange und
kurze Buntstifte, zerknautschte Papierblätter mit meinen
verunglückten Malversuchen und Dinas Hundeleine. Die Kissen fand
ich unterm Bett. Natürlich hatte Dina die dorthin geschleppt.
Dina machte überhaupt nur Unordnung mit ihrer Boxerschnauze. Das
hatte Mutti auch schon gesagt. Unterm Bett lag aber auch mein
Xylophon. Mein geliebtes Xylophon. Das hatte ich ja lange nicht
mehr gesehen. Also pustete und wischte ich den Staub ab. Ich
könnte meinen Kindern ja erst mal ein Lied vorspielen.
Vielleicht das "von Herrn Pastor sin Kau"? Wenn ich nur das
Hämmerchen finden könnte.
Ich rutschte auf dem Boden herum und hob alle Gegenstände an,
die da verstreut herumlagen. Kein Hämmerchen. Ich robbte noch
einmal unters Bett. Da fand ich meine Angel. Als ich sie unterm
Bett hervorzog, schleifte ich am Angelhaken meinen Hausschlüssel
zutage. Er hing an einer Kordel, die ich mir selbst mühsam mit
der Strickliesel aus verschiedenfarbigem Kartengarn angefertigt
hatte. Daran trug ich ihn um den Hals, wenn Mutti zur Arbeit
war. Mein Schlüssel war also wieder da. Ich streifte die bunte
Schlinge über meinen Kopf. Der Schlüssel baumelte mir vor der
Brust herum, wie gewohnt. Dina hatte ihn also verschleppt,
dachte ich, und ich glaubte, ich hätte ihn verloren. Böse Dina.
Ich hatte wieder die Schimpfe eingesteckt. Wo steckt sie
eigentlich? "Diiiina! Hier kommst du her!" befahl ich ärgerlich
und streng. Dina lag irgendwo im Wohnzimmer herum und scherte
sich nicht um mich. Also lief ich zu ihr und rüttelte an ihr
herum. Dina erhob sich gähnend, die Vorderfüße weit nach vorn
und ihr Hinterteil mit dem Schwanzstummel steil nach oben
schiebend, so dass ihr rehbrauner Rücken mit dem glänzenden Fell
eine ideale Rutschbahn ergab. Noch bevor ich rittlings auf ihr
zu sitzen kam, hatte sie sich wieder erhoben, und ich wurde jäh
abgeschüttelt. Dina rannte zur Wohnungstür und schaute mich mit
ihren großen runden Augen bettelnd an. Mein Zorn war verflogen:
Die Leine. Lag sie nicht im Puppenbett??
Da saßen noch immer Karin, Sybille, Antje und Susanne. Hatte das
niedliche Mädchen mit den dicken blonden Zöpfen eigentlich auch
einen Hund? |
|

Sybille

Dina

Christiane mit Dina
|

Ein Weihnachtsgeschenk für Mutter

 |
Etwas Persönliches sollte es sein. Weder Töpfe noch Pfannen, keine Lampen oder Staubsauger. Mutter reagierte empfindlich auf solche Geschenke. Kein noch so nützlicher und wertvoller Haushaltsgegenstand fand als Geschenk ihre Gnade. Auch die so beliebte Seife in mehr oder minder geschmackvoller Verpackung, Parfum oder Eau de Toilette inklusive, empfand sie als ungebührliche Aufforderung zum Waschen.
Neuerdings war oft die Rede von einem Bügelbrett, was in unserem Haushalt fehlte und angeschafft werden sollte. Nun konnten meine Eltern aber nicht einfach in ein Geschäft gehen und ein Bügelbrett kaufen. Erstens gab es die gerade mal wieder nicht. Ein „temporärer Engpass“ wie so vieles andere in unserer jungen Republik. Zweitens musste jede Geldausgabe geplant und dem aktuellen Portemonnaieinhalt gewachsen sein.
Die Bügelbrettbeschaffung war zur Weihnachtszeit noch immer im Gespräch. Vater wiegelte jedoch ab, sodass der Verdacht aufkam, er könnte es bereits gekauft haben. Hätte es nicht in den Jahren zuvor tränenreiche Szenen einer Ehe gegeben wegen derlei Geschenkfehlentscheidungen, wäre er auch bestimmt so unsensibel gewesen, das Fest mit diesem praktischen Utensil zu entweihen. So aber nahm die Heimlichkeit ihren Lauf bis zum Heiligen Abend.
Der verlief wie jeder andere zuvor: Nachdem am Nachmittag der Baum aufgestellt und geschmückt worden war, wurde der Badeofen angeheizt. Erst badete Mutter, dann Vater, dann badete ich. Immerhin war das Badewasser zur Hälfte durch Frischwasser ausgetauscht worden.
Regnete es am Weihnachtsabend, bummerte der Weihnachtsmann immer gerade dann an die Tür, wenn ich in der Wanne saß. Wie sehr ich mich auch beeilte, der offenbar überaus sportliche Greis war wieder einmal verschwunden, wenn ich aus dem Bad kam. Klar. Er hatte es eilig. Millionen Kinder warteten auf ihn.
Bei gutem Wetter gingen Vater und ich, bereits festlich gekleidet, durch die dunklen Straßen spazieren und bestaunten die weihnachtlich geschmückten Fenster. Wenn nach und nach in den Wohnungen die Weihnachtsbäume im Kerzenlicht erstrahlten, wurde es langsam auch für uns Zeit, nach Hause zurückzukehren. Doch der bärtige alte Herr hatte uns wieder einmal ausgetrickst, hatte Mutter die Geschenke übergeben und war verschwunden. Die hatte jetzt nur noch die Pakete unter dem geschmückten Baum anzuordnen, die Kerzen anzuzünden und die Schallplatte „Sind die Lichter angezündet“ aufzulegen. Dann rief sie uns herein.
Im Wohnzimmer herrschte eine so besondere, festliche und anheimelnde Stimmung. wie es nur an Weihnachten möglich ist. Die Augen meiner Mutter glänzten im Kerzenschein vor Rührung, wenn sie mir beim Auspacken und Staunen zusah. Hinreißend schön stand sie inmitten einer Duftkomposition von Apfelsinen, Lebkuchen und Tannengrün und lächelte, glücklich über meine kindliche Freude.
Ich erinnere mich an keines meiner Geschenke, aber die Inszenierung, die dann folgte, und die ich so ungeduldig erwartete, dass ich mich beim Auspacken besonders beeilte, ist mir noch immer gegenwärtig. Dass der Weihnachtsmann nur für uns Kinder zuständig war, wusste ich schon, und auch, dass die Erwachsenen sich gegenseitig beschenkten. So steckte ich mit Vater unter einer Decke, als er Mutter endlich ein etwa eineinhalb Meter langes, flaches Etwas präsentierte. Es war ein wenig ungeschickt, aber doch vollständig in Geschenkpapier eingewickelt. Das eine Ende zierte ein zigarrenkistenförmiger Aufbau.
Mutters Gesicht wurde, wie erwartet, immer länger. Etwas zögerlich zupfte sie an der weihnachtlichen Umhüllung und versuchte Haltung und Fröhlichkeit zu bewahren. „Ein Bügelbrett.“ Trotz höflichen Bemühens geriet diese Feststellung etwas zu trocken und unfröhlich. Aber lange dauerte der erste Schock nicht an, denn bald kam ein rohes, ungehobeltes Brett zum Vorschein, das bei Mutter zwar Erleichterung, aber noch mehr Verwirrung auslöste. Vater schmunzelte und ich durfte endlich loslachen, nachdem ich dieses Bedürfnis schon viel zu lange nur mit Anstrengung hinter Unschuldsmiene zurückgehalten hatte. „Angeführt mit Weihnachtspapier“, wandelte ich das Ätsch - Lied ab und kicherte.
Mutter hatte sich inzwischen bis zur „Zigarrenkiste“ vorgearbeitet. Nochmals fein säuberlich verpackt und mit gelbem Schleifchen versehen, erweckte diese jetzt ihre Neugier, doch es traten nur weitere bunte Päckchen zutage, deren Ausmaß Stück um Stück schrumpfte. Die Aussicht, darin noch ein brauchbares und vor allem dem großen Fest angemessenes Geschenk zu finden, schwand, was sichtbar wurde in den sich mehr und mehr befeuchtenden Augen meiner Mutter. Ihre Tränen schossen aber erst hervor, als sie endlich die golden glänzende Armbanduhr in den Händen hielt. Aber das waren Freudentränen.
Das neue Bügelbrett zog Vater schließlich hinter dem Kleiderschrank hervor. Nun hatte auch dieses den verdienten Geschenkstatus und steigerte die Freude und Zufriedenheit an diesem schönen Weihnachtsabend.
|
|
Augenblicke des Glücks
|
|
Die ersten Novembertage des Jahres 1989, als die Mauer fiel und ein ganz neues Lebensgefühl begann, werde ich nie vergessen.Ich konnte nicht glauben, was ich sah, nicht verstehen, was ich hörte. Ich saß allein in meinem verträumten Obstmuckerstädtchen am Rande Berlins und schaute wie gebannt auf den Bildschirm meines Schwarz-Weiß-Gerätes. Hatte ich richtig gehört? Jeder darf jetzt nach drüben? Auch ohne Verwandtschaft? Einfach so? Ich lief zu meinen Nachbarn. Auch hier saß die ganze Familie versammelt vor dem Bildschirm, unserem Fenster zur großen weiten Welt. „Wie habt Ihr das verstanden?“ wollte ich wissen. „Keine Ahnung. Ich glaube, die brauchen jetzt nicht mehr über die Tschechei. Die können wohl gleich rüber“, vermutete Rainer. Ach so, wieder bloß die andern, die mit dem Antrag. Ich hab’s befürchtet. Das wäre auch zu schön gewesen. Also wieder nicht. Nicht mal nur so gucken. Dabei würde ich ja zurückkommen. Großes Pionierehrenwort. Enttäuscht ging ich zu Bett. Am nächsten Morgen - ich wollte gerade aus dem Haus gehen - ließen mich seltsame Wortfetzen aus dem Radio aufhorchen: ...tanzten auf der Mauer... Tausende jubelten.... Sektkorken flogen... die ganze Nacht.... Ich rannte zum Fernseher und traute meinen Augen nicht. Also doch! Und ich
hatte seelenruhig geschlafen! Mein Herz tobte. Ich vergaß beinahe zu atmen. Glücksschauer durchströmten meine Brust, liefen über meinen Rücken. Tränen brachen unaufhaltsam hervor, die alles um mich herum verschleierten. Ich saß lange bewegungslos, saß und weinte und konnte das übergroße Glück nicht fassen. Dann plötzlich drängte es mich aus der Wohnung, zog mich hin zu meiner Arbeitsstelle, hin zu meinen Kolleginnen und Lehrlingen. Der Unterrichtstag fiel natürlich aus. Das Alltägliche hatte in einer so schicksalhaften Stunde keinen Platz. Mit Schmetterlingen im Bauch, einem Gefühl wie frisch verliebt, plante ich meine erste „Ausreise“. Ich brauchte das Visum, noch heute. Also nichts wie hin zur Meldestelle. Eine johlende, singende und tanzende Menschenschlange bewegte sich langsam die Stufen zur Polizeidienststelle hinauf. Glück, wohin man schaute: Strahlende Gesichter, Verbrüderungsszenen, kreisende Bier- und Weinflaschen. Restbestände an Wunderkerzen und Sylvesterknallern wurden gezündet. Vorüberfahrende Autos hupten den Wartenden zu, die immer wieder „So ein Tag, so wunderschön wie heute...“ anstimmten. Ließ sich besser ausdrücken, was jeder hier empfand? Sogar Petrus spielte mit und schickte strahlenden Sonnenschein. Da mischten sich die Freude über den Sieg der Montagsdemos, die Erleichterung darüber, dass nun nichts Schlimmes mehr passieren konnte, und die Vorfreude auf die künftigen Möglichkeiten, die sich jeder individuell ausmalte. Dieser Moment trug alle in einer großen glücklichen Woge durch den Tag. Endlich saß ich mit meinem Sohn Andy in einem der von der BVG so zahlreich bereitgestellten Doppelstockbusse. Wir saßen oben und ganz vorn und hatten einen herrlichen Ausblick. Still genossen wir den für uns so erhabenen Augenblick und glaubten uns noch immer in einem wunderschönen Traum. Erwartungsvoll schaukelten und ratterten wir über die Autobahn Richtung Dreilinden. Westberlin, wir kommen. Und plötzlich, was war das? Das Rumpeln hatte aufgehört. Fast geräuschlos und weich glitt unser Bus dahin. „ Andy, jetzt sind wir drüben“, sagte ich leise. |

|
|
|
Seht her, ich bin’s. Eine ziemlich derbe Natur, doch ich laß mich gern tragen. Nicht etwa, weil ich blau bin. Nein, ich bin so herrlich praktisch. Deshalb trägt mich jung und trägt mich alt, groß und klein, dick und dünn, eben Hinz und Kunz. Ich bin dabei: bei der Arbeit, in der Freizeit. Auch feiern darf ich und ins Theater - manchmal. Wie scheußlich, wenn dann ein heißes Eisen lange, vertikale Spuren in mich presst. Doch, das kommt schon mal vor. Dabei bin ich hart im Nehmen. Meine Ahnen scheuerten sich an Pferdeleibern. Mich scheuert man mit Steinen, begießt mich mit Domestos, rückt mir sogar mit Messern zuleibe, denn alt hat man mich am liebsten, so richtig verschlissen und zerrissen. Wer kann das schon von sich sagen. Ich bin der King, Namenspatron einer ganzen Generation. Synonym für Freiheit, cool und sexy. Symbol für Abenteuer, wild und zäh. Doch rauchen tun nicht einmal Kamele. Damit hab’ ich nichts an der Hose. Nun sagt schon, wer bin ich... (Jeans) |
|
|
|
Angst vor dem Gewitter

 |
Dunkel wird es am Horizont, lauter und lauter das Murmeln und Dröhnen. Bedrohlich zucken erste Blitze, sekundenlang das schwarze Fenstereck erhellend.Susanne sitzt schon unter dem Tisch, beide Hände an die Ohrmuscheln gepresst, die Augen geschlossen. Da kommt die Großmutter ins Zimmer. „Susanne“, ruft sie, „Susanne, wo steckst du?“ Kläglich kommt es unter dem Tisch hervor: „Großmutter, Großmutter, was soll ich bloß tun? Ich fürchte mich so.“ „Zähle laut bis 777. Dann wird alles gut“, sagt die Großmutter. Susanne zählt 1 - 2 -3....77 - 78 ..99 Da, zisch, ein Blitz. Krach, ein Donner. „Großmutter, Großmutter, was soll ich bloß tun? Ich fürchte mich so.“ „Singe ein Lied. Dann wird alles gut“, rät die Großmutter. „Hänschen klein, ging allein in die weite Welt hin..." singt Susanne. Da, zisch, ein Blitz. Krach, ein Donner. „Großmutter, Großmutter, was soll ich bloß tun? Ich fürchte mich so." Die Großmutter öffnet mit herzzerreißendem Knarren das Türchen ihres schon wurmstichigen Wandschränkchens mit den bunten Butzenscheiben und holt ein dickbauchiges Fläschchen hervor, das im Blitzschein karminrot aufleuchtet. „Hier, trinke ein Schlückchen", sagt die Großmutter und reicht Susanne das Fläschchen. Susanne trinkt. Hmmm. Da, zisch, ein Blitz. Krach, ein Donner. Susanne trinkt noch einmal. ‘Das muss ein Zaubertrank sein’, denkt sie. Da, zisch, ein Blitz. Krach, ein Donner. Und trinkt wieder. „Ach, wie wird mir so wohlig? Was für eine Medizin!“ Die Flasche gleitet langsam aus ihren Händen. Seelig
lächelnd sinkt Susanne in Großmutters Häkelkissen. Die kommt gerade wieder zur Tür herein. „Doch nicht die ganze Flasche, Dummchen", seufzt Oma kopfschüttelnd. „Mein schöner Kirschlikör..." |
 
|
|
|
Vor neun Jahren in Berlin,ahnungslos und nichts im Sinn, komm’ ich, Marschmusik im Ohr, an das Brandenburger Tor. Regen gießt auf mich herab. „Gut, dass ich den Schirm hier hab’“, denke ich und steh’ herum so wie alles Publikum. Ost und West wird heut’ vereint. Mancher, der da Tränen weint’, als Herr Kohl die Rede schwang. Ach, wie ist allein mir bang! Überall die Polizei! Und, oh Schreck, da stehen zwei, pudelnass, zum fürchten gar. Ach, wie ist mir sonderbar. Und sie kommen zu mir her. Ob noch Platz am Schirm wohl wär’ ? Wenn die Zigaretten weichen, wär’ das schade ohnegleichen. Das kann ich nur gut verstehn, rücke etwas näher hin. So begann, was heut’ noch währt. Und? Das war doch nicht verkehrt? Lieber Schatz, gib es doch zu: Ohne mich - nur halb wärst du, aber mit mir doppelt wert. Was das Leben uns beschert’, gilt es heute zu gedenken. Dies Gedicht will ich dir schenken und ein Päckchen, klitzeklein. Immer will ich bei dir sein! |

|
Wenn die Weihnacht naht mit Macht,ist das meiste schon vollbracht, was im alten Jahr geplant. Was noch nicht geschafft ist, mahnt, dass im neuen Jahr es werde. Wohl das schönste auf der Erde bleibt, wenn Traum und Wirklichkeit sich berühren. Sei bereit, deinen Traum mit Lust zu leben in die Wirklichkeit zu weben. Nur mit Mut dir das gelingt. Höchstes Glück dein Streben bringt. Frohe Weihnacht! Heil und Frieden, sei dir allezeit beschieden. Guten Rutsch mit Schall und Rauch! So ist der Silvesterbrauch. Dieses neue Jahr, du weißt, letztmals neunzehnhundert heißt, was uns so vertraut im Ohr. Eine Wende steht bevor. Diesmal aber für uns all’. Auf dem ganzen Erdenball wird ein Fest sein, schrill und brausend, Gruß dem kommenden Jahrtausend. Also halt die Ohren steif. Aus dem vollen Leben greif’ deinen Teil dir mit Bedacht, was dir wirklich Freude macht, was dir nützt und was dich heilt, denn die Lebensuhr, sie eilt, nur zu schnell, Gott weiß wohin. Gruß Christiane (aus Berlin) |
|
 Mein Geburtshaus sieht heute so aus. 
Mein Kuchen schmeckt besser als der von Onkel Winkelmann 
Oma hat sich schick gemacht 
Lothar und ich 
An der "Russenmauer" 

Vor dem Bretterzaun 
Mit Spielkameraden und meinem Hund Pucki vor Omas Haus Friedensweg 11 |
Mein Geburtshaus steht in Gardelegen in der Altmark. Die Bäckerei Winkelmann in der Stendaler Straße 26, über der die kleine Wohnung meiner Eltern lag, gibt es nicht mehr, dafür hielten sich lange noch der "Konsumbäcker "an der gegenüberliegenden Straßenseite, die Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule und das Städtische Wannenbad. In der Schule verbrachte die zweite Hälfte meiner ersten Klasse, in letzteres gingen die Familien früher zum Baden, vor allem an den Wochenenden. Eigene Bäder waren noch die Ausnahme. Diese Badeanstalt war eine düstere, kellermuffige Höhle mit verschließbaren, spärlich ausgestatteten Separées: Ein Stuhl, glitschige Lattenroste am Boden, eine riesige Emaillewanne mit Rost- und Kalksteinflecken, in die sich aus dicken schwitzenden Rohrleitungen laut tosend ein heftig dampfender Wasserstrahl ergoss, der den ganzen Raum in eine Wolke hüllte. Meine Oma wohnte nicht weit entfernt im Friedensweg 11, einem kleinen Vierfamilienhaus, in dem meine Großeltern die rechte obere Etage bewohnten. Auf dem Hühnerberg. So hieß der Friedensweg im Volksmund. Dort verbrachte ich einen bedeutenden Teil meiner Kindheit. Auch wenn meine Eltern schon bald nach Brandenburg an der Havel zogen, ich dort die Schule besuchte und das ganze Jahr über dort lebte - in den Ferien fuhr ich mit dem Zug zu Oma, allein, mit Umsteigen in Rathenow und Stendal. Wie eine Weltreise kam mir das immer vor. Anfangs drückte mich dann der Abschiedsschmerz, später löste eine kribbelnde Vorfreude ihn ab. Oma holte mich von der Bahn ab. Ich sehe sie noch auf dem Bahnsteig, während der Zug einfährt, winkend und lachend, um acht Wochen später wieder dort zu stehen, schluchzend mit einem viel zu kleinen Taschentuch, wenn er sich wieder in Bewegung setzte in Richtung Brandenburg, mit Christianchen. Oma wurde immer kleiner mit den Jahren, fand ich. Fritz Edeling war mein Opa und ein
ABV, ein Abschnittsbevollmächtigter der Deutschen Volkspolizei, und in dieser Eigenschaft wahrscheinlich ein scharfer Hund. Jedenfalls kläffte er aus dem Küchenfenster heraus jeden lautstark an, der mit seinem Fahrrad den halbwegs ebenen, sandigen Fußweg benutzte, um dem schmerzhaften Rütteln und Schütteln auf dem rumpeligen Kopfsteinpflaster zu entgehen. Die meisten traten etwas schneller in die Pedale und waren auch schon vorüber. Nur wenige beeindruckte sein Drohen so, dass sie abstiegen und schoben oder auf die massakrierende Fahrbahn wechselten. Bei Oma und Opa gab es sogar ein Telefon. Natürlich ein Diensttelefon. Und wenn das klingelte, rannte Oma in die gute Stube an den Hörer. Opa brüllte laut sein „Bin nicht da!“ hinter ihr her. Dann brummelte er jedes Mal schimpfend vor sich hin, wobei seine dicke braune Hornbrille auf der Nase auf und nieder hüpfte. Oma rief: „Fritz! Das VPKA!“, und meinte das Volkspolizei-Kreisamt, seine Dienststelle. Opas Tonfall veränderte sich am Apparat sofort, man hörte nur „Ja“ und „Selbstverständlich“ und „Komme gleich“. Opa stand stramm und gehorchte. Doch legte er auf, ging das Geschimpfe sofort wieder los. „Die sind beschissen mit ihre Maiblumen…“ war immer dabei. Dann schnallte er das Koppel um, ergriff seine braune lederne Kartentasche, setzte die polizeigrüne flache Schirmmütze auf und verließ die Wohnung, um auf das ebenso polizeigrüne Dienstfahrrad zu steigen. Mit blitzeblanken Polizeistiefeln. War er weg, wurde es so richtig gemütlich in der kleinen Wohnküche. Ich hopste im Nachthemd auf dem alten Sofa herum, vor dem der schmale Küchentisch stand. Wenn ich die Beine baumeln ließ, stieß ich an die Emailleschüssel, die Oma immer unter dem Tisch hervorholte, wenn sie nach dem Mittagessen den Abwasch erledigte. Bis dahin wurde darin das benutzte Geschirr gesammelt. Und wenn ich zu sehr hopste, klapperte es bedrohlich.
Dann drohte auch Oma schon mal mit dem Zeigefinger, aber nicht wirklich. Es gab frische Brötchen mit Butter, die Oma längs der Kerbe durchschnitt, damit ich besser stippen konnte. Stippen war das Größte. Der Kaffee bekam dicke gelbe Augen, und ab und zu fiel ein Stück Brötchen hinein. Dann schwappte er über. Ich angelte mit den Fingern in der heißen Brühe, und es schwappte noch mehr auf die mit winzigen Messerschnitten übersäte Wachstuchdecke. Oma kam mit dem Lappen. So schaffte ich drei bis vier Brötchen am Morgen – und wahrscheinlich auch meine Oma. Nach dem Frühstück kam ich meist mit Katzenwäsche davon, aber manchmal hatte Oma kein Erbarmen. Sie stellte mich auf einen Küchenhocker und rubbelte heftig mit kaltem Waschlappen an mir herum. Es gab nur einen Emailleausguss an der Küchenwand, darüber den Kaltwasserhahn und darüber einen Klappspiegel mit Konsole. Links daneben hing ein Holzkästchen, nicht viel größer als eine Zigarrenkiste, mit handbemaltem aufklappbarem Deckel. Darin lagen Kamm und Bürste. Ich wand mich unter Kichern und Quietschen, und wenn Oma dann ihren kleinen Finger zu Reinigungszwecken in mein Ohr bohrte, entwischte ich ihr meist. „Christajane“ rief sie mir nach, doch ich verschwand in der kleinen Kammer gegenüber der Küche. In diesem „schmalen Handtuch“ standen ein Holzbettgestell mit Federbett und ein kleines Schränkchen an der linken Seite, rechts ein einfacher Kleiderschrank und eine alte Kommode mit Waschschüssel und Wasserkanne aus Porzellan. Der Spiegel darüber war teilweise erblindet. Alles sah alt und schäbig aus. Eine Abstellkammer war das und nicht einmal beheizbar. Aber es war mein Reich für acht lange Wochen. Unter dem Bett lag der geöffnete Koffer mit den Kleidungsstücken, die ich mitgebracht hatte.
Eigentlich wohnte Ursel in diesem Zimmer. Ursel war schon eine junge Dame, und ich frage mich heute, wo sie sich aufhielt, wenn ich ihr Bett für lange Wochen in Beschlag genommen hatte. Die ganze Zeit in Urlaub? Oder bei Freunden? Nur manchmal war sie da und schlief auf dem viel zu kurzen Sofa in der Küche: Ursel war fast einen Meter neunzig groß, stand lange vor mir auf und kam abends erst zurück von ihrer Arbeit als Fakturistin beim VEB Kraftverkehr, meist mit einem Bärenhunger. Dann briet sie sich am liebsten ein Kotelett, und mir brachte sie auch eins mit. In der Woche extra Fleisch war bei den Edelings noch immer nicht üblich. Und die Wurst „ihl“ zu essen, also ohne eine Scheibe Brot dazu, das gab es einfach nicht. Ursel war moderner. Sie ging zum Eisessen ins Jugendcafe’ und trug Perlonstrümpfe. Doch wegen ihrer Größe hatte sie es nicht leicht mit Verehrern. Ursel hieß nicht Edeling, was mich als Kind verwunderte. Sie war für mich Omas Tochter, denn sie sagte Mama zu ihr, sie hieß aber Ursula Sabinski und war ein Flüchtlingskind aus Schlesien. Nach dem Krieg vorübergehend in Pflege genommen, blieb sie auch, als sich viel später die Mutter aus Belzig meldete. Ursel kannte diese Frau nicht, und nichts und niemand konnte sie von ihrer Mama trennen. In meiner Ferienkemenate gab es ein einziges schmales Fenster. Auf dem Stuhl davor konnte ich knien, um auf den Hof zu schauen oder nach links zum Nachbarfenster. Ich klopfte an die Wand über dem Bett und öffnete, nachdem mein Klopfen erwidert worden war, das Fensterchen. Nebenan lag Lothar schon auf der Lauer. Lothar, der etwa gleichaltrige Nachbarssohn mit feinen, glatten, weißblonden Haaren und verschmitztem Grübchenlächeln steckte meist in viel zu kleinen, abgetragenen Kleidungsstücken. Er war mein bester Freund. Wir kicherten, heckten unsere Pläne für den Tag aus und trafen uns kurz darauf auf der Flurtreppe. Es war ein heller, freundlicher Flur, in dem es nach Bohnerwachs duftete, mit einem schönen glatten Treppengeländer. Kein Nagel, kein Holzsplitter hemmte unseren sportlichen Drang. Wir machten Halt auf dem ersten Treppenabsatz. An der sonnigen Fensterfront wärmten und tummelten sich Unmengen von Fliegen. Es begann unsere tägliche Fliegenfängerolympiade. Da wir beide gleichgut fangen konnten, war es jeden Tag ein neuer spannender Wettkampf. Und es gab auf dem ganzen Hühnerberg keinen, der es mit uns aufnehmen konnte. Kein Zweifel. Wir würden heiraten. Später einmal. Lothar und ich. „Wenn wir groß sind, fahren wir nach Moskau, und ich kaufe dir schöne Kleider“, hatte er mir mehr als einmal versprochen. Warum hatten Oma und Lothars Mutter immer so laut losgelacht, wenn sie es hörten? Uns war es ernst. Moskau war wunderschön und riesengroß, reich und modern. Dort gab es nur gute und kluge und mutige Menschen. Dort war Kommunismus. Uns zog es dorthin und in die geheimnisvoll schöne Zukunft, die wir uns, achtjährig erst, nur gemeinsam vorstellen konnten. Und wir erinnerten uns an den Vormittag im Februar 1953, als sowjetische Soldaten schweigend, weiße Nebelschwaden atmend, die in dicken wärmenden Pelzmützen steckenden Köpfe auf den graugrünen Wintermänteln balancierend, durch die winterkalte Stadt zogen. Einer ebenso vermummten Militärkapelle folgend, bewegte sich der Trauerzug langsam vorüber. Dieses „Unsterbliche Opfer“ machte uns traurig. Erwachsene Männer weinen zu sehen, verwirrte und beeindruckte uns Kinder. Das musste ein ganz besonders wichtiger und guter Mensch gewesen sein, dieser Stalin. Nun war er tot.
Stalin, Lenin, Jura, Sascha, Schura, Wowa hießen die Helden in unseren Spielen „Gute“ gegen „Böse“. Unsere Spielgefährten mit den schönen Namen Manfred, Marlies, Helmhard, Wolfhard, Horst und Volker wurden zu heldenhaften Russen, kämpften meist gegen imaginäre Feinde. Der Sieger stand fest: Die ruhmreiche Sowjetarmee. Deshalb musste man Wolodja oder Katja heißen. Aber jeder war auch mal Verlierer. Sonst gäbe es ja keine Gegner. Holzstöcke wurden zu Maschinengewehren. Mit einem „Drrrrrr“ mähten wir ganze Bataillone von Deutschen nieder. Pistolen ahmten wir nach mit dem nach vorn gestreckten Zeigefinger der rechten Hand, den Daumen als Zielvorrichtung gebeugt. Die beliebteste war die „Mauser“, hinterhältig klein, dass sie sogar in einer Kinderhand verschwinden konnte und plötzlich, von der Phantasie zutage befördert, den Gegner überraschen und überwältigen konnte. So eine Waffe nahm man den Agenten vom Amerikanischen Geheimdienst ab. Die spielten eine subversive Rolle und mussten ausgeschaltet werden. Wer eine Pistole auf sich gerichtet sah und ein scharfes „Puch“ oder „Peng“ hörte, hatte umzufallen, sonst wurde er angeschrien: „Du bist tot, du bist getroffen.“ Der verzweifelte Versuch, nicht vorzeitig aus dem Spiel zu müssen, hörte sich meist so an: „Ich hab mich aber geduckt, die Kugel ist am Ohr vorbei. Ich hab’s doch zischen gehört.“ Meist bestand der Schütze jedoch auf seinem Treffer, und erbitterte Verhandlungen unterbrachen den Kampf. Manchmal wurde für den „Gefallenen“ schnell eine neue Identität erfunden. Besonders Sensible verließen den Schauplatz auch schon mal heulend und schluchsend. Wir sprachen natürlich russisch, bemühten uns in unserem Kauderwelsch das „Rrrr“ zu rollen, wie wir es von den Soldaten hinter der hohen Bretterwand kannten. Nach jeder derartigen Äußerung - nur stoj, dawaj, da da, net und durak kannten wir im Original - folgte die deutsche Übersetzung. „Du hast wohl wieder Hummeln im
Hintern? Erst wird gegessen!“ Unter der unnachgiebigen Aufsicht meiner Oma, mit vor Eifer noch geröteten Wangen und quälender Ungeduld verschlang ich das Mittagessen, den letzten Bissen noch im Treppenhaus kauend. Neue Strategien waren ausgedacht und drängten, umgesetzt zu werden. Nach dieser von höherer Gewalt verordneten Kampfpause versammelten sich die gegnerischen Heere wieder auf dem Kriegsschauplatz, und der befand sich auf dem „Hühnerberg“, einer kleinen nadelöhrförmig ausgestreckten Wohnenklave, die sich in das von sowjetischen Truppen besetzte Gebiet schob. Auf der linken „Nadelöhrseite“ stand eine zweistöckige Häuserreihe, deren Hofgrundstücke mit Schuppen und Stallungen an dem erwähnten Bretterzaun endeten. Unmittelbar dahinter lagen die Panzergaragen und Exerzierplätze der "Russen". In der rechten Wohnzeile ähnlicher Bauart, an den Schießplatz grenzend, waren ähnlich einem Altenheim nur ruhebedürftige alte Menschen untergebracht. Dort öffnete sich, während wir spielten, mal dieses, mal jenes Fenster, wenn die ihrer Hörkraft noch nicht gänzlich beraubten Bewohner unseren Gefechtslärm nicht mehr ertragen konnten. Wir wurden kräftig ausgeschimpft und drehten unseren Lärmpegel herunter, was aber nicht lange anhielt. Die beiden gegenüberliegenden Häuserreihen waren am oberen Teil durch eine Mauer verbunden, die Zugang und Blick auf das Militärgelände verwehren sollte. Dort lagerten die Bewohner ihre Holzvorräte für den Winter in großen Stapeln, so dass wir die Mauerbrüstung erklettern konnten. Innerhalb dieses Hufeisens gab es ein ovales Stück baumbestandener Wiese. Das war der gemeinschaftliche Platz zum Wäschetrocknen. Er war von einem Sand- und Schotterweg eingeschlossen, der in eine etwas abschüssige Straße mündete. Längs dieser Richtung Stadt führende, etwa zehn Meter breiten Kopfsteinpflasterstraße stand das Vierfamilienhaus, in dem Lothars Familie und meine Großeltern die obere Etage mit freiem Blick auf das „Russengelände“ bewohnten. Die morgendlichen Appelle vor unserem Küchenfenster waren für uns Kinder ein interessantes Schauspiel. Auch die Wartung der Panzer, die an jedem Vormittag ins Freie gefahren wurden, verfolgten wir mit größtem Interesse. Die losen Bretter im Zaun kannten wir
alle. Man musste sie nur vorsichtig beiseite schieben, schauen, ob die Luft rein war, und konnte hindurchschlüpfen. Die Panzersoldaten hatten uns Kinder gern. Sie ließen uns ins Panzerinnere klettern. Das war Abenteuer pur, denn wir mussten ständig auf der Hut vor den Offizieren sein. Die Gefahr, augenblicklich entdeckt und mit bösen Drohungen wie „Du Kommandatura“ verjagt zu werden, machte den Nervenkitzel aus. Das warnend geraunte „Offizerrr“ klingt mir noch heute in den Ohren. Die einfachen Soldaten waren uns auch so wohl gesonnen, weil wir sie mit Weißbrot, dem „Chleb“, und Wodka versorgten. Wir waren ganz scharf darauf, für sie einkaufen zu gehen, denn das Wechselgeld durften wir stets behalten. Dass sie das Weißbrot immer sofort hastig in sich hineinstopften, den Kopf noch durch die Bretterluke geschoben, verwunderte uns. Von richtigem Hunger hatten wir keine Ahnung. Die jungen, vom Heimweh geplagten Männer zeigten uns Fotos aus ihrer Heimat, von ihren Eltern, Geschwistern und Bräuten mit den hohen Wangenknochen, langen dicken Zöpfen und bunten Kopftüchern. Sie schenkten uns Abzeichen, die Panzer, Flugzeuge, U-Boote darstellten - je nach Waffengattung. Und sie zeigten uns, wie man mit einem winzigen Stückchen Prawda, zu einem Tütchen gedreht, Machorka rauchen konnte, den grobgehäckselten russischen Billigtabak, der so süßlich roch, im Hals kratzte und uns das Rennen lehrte. Und so hatten sie mit der Sehnsucht nach ihrer Heimat bei uns dieses Fernweh ausgelöst. Moskau. Wenn wir erst groß sind... |
|
21.Dezember 2012 Heute sollte nach dem sog. Maya-Kalender mal wieder ein Weltuntergang stattfinden. Dazu hatte ich mir meine Gedanken gemacht. 



|
Warum soll ich heut' noch sparen? Kaufe mir, was mir gefällt. Warum noch Makeup auftragen, Wenn doch alles gleich zerschellt? Was geschieht mit den Geschenken, die verpackt schon weihnachtlich. Muss ich an die Miete denken? (Lieber denke ich an dich!) Warum überhaupt bezahlen? Jede Rechnung käm' zu spät. Lohnt es sich, ein Bild zu malen, wenn der Erdball untergeht? Muss ich noch mal Wäsche waschen, Haare kämmen, Nägel feilen? Kann ich Schokolade naschen, ohne sie dosiert zu teilen? Wahllos in den Kühlschrank greifen! Alles gönn' ich mir noch mal. Endlich auf die Taille pfeifen! Schluss mit der Diätenqual. Gib' mir schnell noch mal
'ne Kippe, Lunge hin und Lunge her. Kommt der Alte mit der Hippe, macht das sowieso nichts mehr. |
Mit Verlaub: Es ist doch fair, dass auf meine letzten Tage ich mich trau, was ich nie tat, mal über die Stränge schlage, wo doch schon das Ende naht. Sage vor dem großen Knall: Hallo Chef, du kannst mich mal...! Lohnt es sich, zu Bett zu gehen, wenn ich bald für immer ruh'? Irgendwas muss noch geschehen Vor dem Aus. Und was meinst du? Sollen wir uns jetzt betrinken Oder lieber tanzen geh' n? Wenn die letzten Sterne blinken, Will ich hoch zum Himmel sehn. Endzeit, Endzeit ist gekommen! Glaube, wer es glauben mag. Das bleibt euch gern unbenommen. Ich begrüß den neuen Tag: Juchhu!

christiane schiefen © |
|
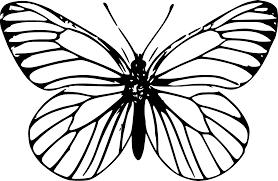 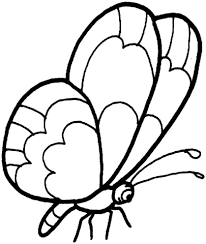  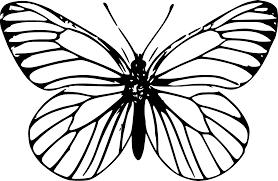 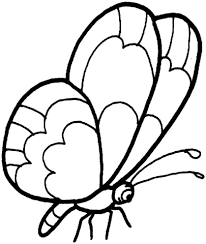
|
Da war der mit Acker- und Zaunwinde bewucherte Maschendrahtzaun, der jeden Sommer den so hässlichen schwarzen, halb verfallenen Bretterzaun gegenüber dem Haus meiner Oma schmückte. Scharen von Schmetterlingen - Kohlweißlinge meist, vereinzelt gelbe Zitronenfalter - trugen zu dieser Inszenierung bei. Die zartrosa und weißen Blütentrichter lockten mit ihrem durchdringenden Honigduft auch Hummeln und Bienen an, so dass ein Flattern, ein Brummen und Summen auf dem blütenübersäten Grund herrschte. Die warm aufsteigende Luft flirrte und flimmerte. Ich sog den süßen Nektar aus den Blumenkelchen und genoss ihren zarten Duft. Ich erinnere mich... Ich jage Schmetterlinge, halte sie mit meinen kleinen, zu einer winzigen Höhle geformten Händen gefangen. Ihr ängstlicher Flügelschlag kitzelt. Um sie in die bunt beklebte hölzerne Zigarrenkiste zu sperren, greife ich sie an einem Flügel und lüfte mit der anderen Hand den Deckel, einen kleinen Spalt nur, um die bereits gefangenen nicht entwischen zu lassen. Dabei schlagen die hauchzarten Geschöpfe so panisch mit dem noch frei beweglichen Flügel, so dass, reißt sich einmal eines der Tiere los, ein kleines Stückchen davon oder auch nur der feine weiße Staub, der sie matt bedeckt, in meiner Hand zurückbleibt. Ich trage sie in die Gartenlaube hinter unserem Haus und entlasse sie aus ihrem engen, dunklen Gefängnis. Sofort fliegen sie zum Licht, das durch die sorgsam geschlossenen Fenster fällt. Doch dort ist ihre vermeintliche Freiheit schon wieder zu Ende. Mit ihren dünnen Krabbelbeinchen laufen sie an der glatten Scheibe entlang, versuchen hin und wieder einige Flügelschläge, um schließlich erschöpft und unbeweglich,
sich an den bröckelnden Fensterkitt klammernd, ihr Schicksal anzunehmen. Doch ich habe noch immer kein Erbarmen. Mit Daumen und Zeigefinger packe ich sie an den zusammengefalteten Flügeln und setze die mit ihren Beinchen hilflos zappelnden Insekten wieder und wieder an die Hängelampe oder an einen anderen Platz gegenüber dem Fenster. Bereits ermattet, doch von großem Freiheitsdrang getrieben, fliegen sie zurück zum Licht, bleiben dort sitzen oder fallen kraftlos zu Boden. Weil mich dieses Spiel endlich langweilt, entlasse ich die Geplagten. Allerdings sind sie nun schon schwer angeschlagen, ihre Flügel durchsichtig oder nicht mehr vollständig. Für so manchen kommt die Freiheit zu spät. |
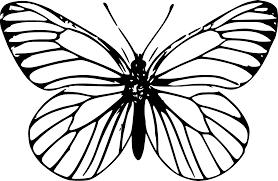    
|
 |
|